Reisen Startseite

Von Waldsassen
aus ist Schwandorf nicht gerade der nächste Weg. Warum wählten wir
gerade diesen Ort aus? Das hat zwei wesentliche Gründe.
Dieses Jahr (2018)
waren wir drei mal auf Stadttour in Schwandorf. Der Hintergrund:
Lorle hatte einen Gutschein von Ihren Kollegen zum Abschied bekommen, den es
galt umzusetzen.
Warum Schwandorf? Weil sie schon immer mal die Felsenkeller besuchen wollte.
Weil wir auch gerne
essen, waren es drei kulinarische Stadtführungen, die meine Frau buchte.
Jede der drei Führungen brachte neue Informationen zur Entstehung, der
Geschichte, und zu
den Sehenswürdigkeiten der großen Kreisstadt an der Naab, natürlich
auch zu den Felsenkellern.
Gleich vorne weg
- wer Interesse an den kulinarischen Stadtführungen hat, sollte sich rechtzeitig
anmelden.
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt und die Termine sind nicht so zahlreich.
Und eines ist zu bemerken: wir waren jedes Mal begeistert.

Naabarm an der Fronberger Straße - wer genau hinschaut, erkennt in
diesem Foto den Hintergrund der Titelzeile.
In Schwandorf gliedert
sich die Naab in drei Arme auf. Eine lange Brücke führt über
alle drei hinweg
zum Festplatz am rechten Naabufer. Dort gibt es reichlich Parkmöglichkeiten.
Für Leute, die sich zufuß
schwer tun, ist der kleine Parkplatz an der Spitalkirche gleich an der Fronberger
Straße empfehlenswerter.
Von hier führen die Pfleghofstufen hinauf zum Ausgangspunkt der Stadtführungen
am
Touristbüro gegenüber der Kirche St. Jakob. Ein Weg mit moderaterer
Steigung ist die
Spitalstraße entlang bis zur Nürnberger Straße und über
die Pfleghofgasse zum Treffpunkt.



Die Pfarrkirche St. Jakob wurde zu Beginn des 15. Jhd. im spätgotischen
Stil erbaut. Das Tonnengewölbe stammt aus dem Jahr 1678.
Der Altar ist neugotisch und stellt die Berufung und Hinrichtung des Hl. Jakobus
dar. Mit seinen 49 Metern Höhe ist der Kirchturm eines
der Wahrzeichen von Schwandorf.

"Verliebt in Schwandorf"
Der historische
Pfleghof ist heute der Sitz von VHS und Touristinfo. Das Gebäude ist eines
der ältesten der Stadt. Hier
residierte früher der Pfleger, also der Stellvertreter des Landesherrn.
Er war Richter und Finanzchef. Als letzterer konnte er
Zölle und Steuern erheben zum Leidwesen der Fischer und Lastkahnbetreiber,
die hier eine Anlegestelle hatten.
Die erste Tour
startete Anfang August. Den Titel kann man in zweierlei Weise deuten. Verliebt
in die Stadt Schwandorf
oder in einander verliebt in Schwandorf. Angesichts der Musikanten, die sich
zur Führung am Treffpunkt einfanden,
trifft wohl eher die zweite Deutung zu. Denn zum Auftakt und dann an weiteren
markanten Stellen der Führung
brachten die drei jeweils ein Ständchen mit Liebesliedern zu Gehör.



Kleiner Umtrunk zur Stärkung nach einem "anstrengenden" Aufstieg
zum Blasturm
Die Musikanten
waren uns zum Blasturm schon vorausgeeilt und nach dem Ständchen gab es
zur Stärkung
einen kräftigen Schluck Schwandorfer Drachenblut, einem Likör den
der Gartenbauverein herstellt.

Danach ging es
hinauf zu den Obergeschoßen des Blasturms, die nur über die Außentreppe
zu erreichen sind.
Das diente in früheren Tagen der Sicherheit bei Feindeinfall.
Im Blasturm war
in alten Zeiten das Domizil des Turmwächters, der durch Hornsignale mitzuteilen
hatte,
wenn sich die Postkutsche oder der Feind näherten oder wenn ein Brand ausbrach.
Ein besonderer Turmbewohner war ein gewisser Konrad Max Kunz. Der Sohn des
damaligen Türmers und der Hufschmiedstochter
Barbara Metz erblickte im April 1812 das Licht der Welt.
1860 komponierte Max Kunz ein Lied
mit dem Titel "Für Bayern". Der Text des Liedes stammte von einem
Lehrer,
welcher einen Gedichtband veröffentlicht hatte. Das Lied von Konrad Max
Kunz,
dem berühmtesten Schwandorfer, wird seit dem 29. Juni 1966 als Bayernhymne
gesungen.
Kunz wirkte lseit 1845 als Chormeister am Königlichen Theater in München.
Er starb im August 1875.
Eine Marmorbüste von Schwanthaler zierte sein Grab auf dem Münchner
Südfriedhof bis zum August 1979.
In diesem Jahr wurden seine sterblichen Überreste in den städtischen
Friedhof von Schwandorf
überführt.


Eine weitere bekannte Persönlichkeit ist mit dem Blasturm verbunden, der
Maler Carl Spitzweg.
Nach einer seiner Handskizzen malte er 1860 ein Bild mit dem Titel "Schwandorfer
Stadtturm im Mondlicht".
Es hängt heute im Georg-Schäfer-Museum in Schweinfurt, weil es trotz
eines,
aus jetziger Sicht, günstigen Angebots an die Stadt Schwandorf
von den Stadtvätern in der Vergangenheit nicht erworben wurde.
 |
 |
| St. Jakob vom Blasturm aus | St. Jakob vom Markplatz aus |
Auf diesen beiden Bildern gibt es zwei Besonderheiten zu entdecken.
Der Kirchturm hat
zur Markseite hin zwei Turmuhren, damit zwei Leute gleichzeitig nach
der Uhrzeit sehen können, unken die Schwandorfer.
Zum anderen ist
die Form des Marktplatzes ein Dreieck mit der Spitze an der Kirche, am unteren
Ende wird er breiter.
Bei genauem Betrachten bemerkt man, dass die Häuser nach unten hin immer
ein Stück nach hinten versetzt
sind und dass von jedem Haus ein Fenster zum unteren Markt hin schaut.
Diese Fenster nennt man in Schwandorf "Neugierdfenster", weil sie
den Bewohnern
jedes Hauses ermöglich(t)en, das mit zu bekommen, was auf dem Marktplatz
grade passiert(e).
Der Abschluss der
Führung "verliebt in Schwandorf" endet mit einem Candle-Light-Dinner
im Gasthof
Hufschmiede aus dem die Mutter von Konrad Max Kunz stammte. Der Schmiedebetrieb
wurde 1965
eingestellt und seit 2002 befindet sich hier ein sehr schönes Restaurant.
Das Essen ist lecker bei noch erschwinglichen Preisen. Eine Besonderheit sind
die
angebotenen Tapas, Vorspeisen oder Appetithäppchen nach spanischem Muster.


"Fischers Fritz fischt"

Das war das Thema
der zweiten kulinarischen Tour in Schwandorf. Auch hier gab es neben
Informationen zur Stadt ein Menü, das aber anders wie das erste Mal auf
zwei Stationen aufgeteilt war.
Doch zuerst führte der Weg vom Pfleghof hinüber in den Stadtpark,
der quasi auf einer Insel in der Naab liegt.

Blick über die Naab zum Festplatz am rechten Ufer
Unser Guide wusste
einiges über die Lage der ersten Siedlung an der Naab. Die Geschichte geht
zurück auf das Jahr 1006
in dem die Siedlung erstmals unter dem Namen "Suainicondorf"in einer
Urkunde des
Klosters St. Emmeram zu Regensburg schriftlich erwähnt wurde. Die Deutung
des Namens ist bis heute unklar
obgleich archäologisch gesichert ist, dass in das Gebiet von Schwandorf
Slaven eingewandert sind und
der Name der Stadt wohl auf slavische Wortbedeutungen zurückgeht.
Fest steht auch,
dass im Fluss mit reichlich großen Angelhaken gefischt worden ist.
Die Nachbildung im Foto hatte der Gästeführer dabei.


Dieser junge Herr
von der Fischerzunft aus dem Mittelalter sprang urplötzlich hinter einem
Busch hervor,
als die Gruppe den Schilderungen des Fremdenführers lauschte. Er berichtete
vom Leben als
Fischer und von deren Rechten und Pflichten. Gut gelungene Einlage!


Nicht nur Fischer
gab es an der Naab, mit der Energie des Wassers wurden auch Mühlen angetrieben.
Weil es dort heute keine Mühlen mehr gibt (die letzte Mühle wurde
1970 geschlossen),
treiben die Wasserräder Generatoren an, deren Energie zur Beleuchtung des
Stadtparks verwendet wird (wenn die Anlage grade mal funktioniert, meinte der
Guide).

Über den Steg
bei den Wasserrädern und den Stettnerplatz kamen wir zurück in die
Altstadt. Einige Straßennamen
wie Egerländerstraße, Sudetenstraße und Böhmische Torgasse
lassen vermuten, dass hier nach dem 2. Weltkrieg viele Heimatvertriebene ein
zweites Zuhause fanden.
Im Ergeschoss des Hauses mit dem grünen Puschel findet man einen weiteren
Hinweis darauf,
die Falkenauer Heimatstube. Der bekannte Bandleader Ernst Mosch wurde übrigens
auch in Zwodau (heute Svatava) in der Nähe von Falkenau (heute Sokolov)
geboren.

Das Stettnerhaus steht an der Stelle, an der bis 1970 die Stettnermühle
in Betrieb war.
Im Erdgeschoß befindet sich die Falkenauer Heimatstube.

Hier am unteren
Marktplatz gibt es ein Glockenspiel aus dem Jahr 1990, das täglich um 10
Uhr und 17 Uhr
die Bayernhyme spielt. Ein weiteres Highlight wird in der dritten Führung
vorgestellt.

Nach dem umfangreichen
Marsch durch den Park und die Stadt gab es den ersten Gang des kulinarischen
Teils der Führung.
Im Färberhaus, gleich neben der Hufschmiede, ließen wir uns bei einem
Glas Wein den Salat mit Fischmousse schmecken.

Die Karte entspricht in Preis und Qualität, ebenso wie das Ambiente,
den Gegebenheiten in der Hufschmiede.
In beiden Lokalen ist urgemütlich.

Beim Rückmarsch zum Touristbüro bewunderten wir den herrlichen
Blumenschmuck am Stadtmuseum
Wieder an der Touristinfo
angekommen, gab es eine zweite historische Einlage. Der "Pfleger",
also der Vertreter
des Landesherrn, eilte aus der Tür des Pfleghofs. Auch er erzählte
viel über die Geschichte der Stadt. Zum Beispiel
dass Schwandorf im Landshuter Erbfolgekrieg 1504 bis auf drei Häuser niederbrannte
und dass es in der Zeit von 1555 bis 1617
evangelisch-Lutherisch war, da es bis 1777 zum Fürstentum Neuburg an der
Donau gehörte.
Leider gibt es
von der letzten Station der Fischführung kein vernünftiges Foto. Dafür
schmeckte das Hauptgericht
im Café Grosser am Festplatz ganz vorzüglich - Welsfilet im Speckmantel
mit Petersilienkartoffeln und einer leichten Weinsoße.
Das Nachkochen ist übrigens ganz einfach, ich hab's probiert.
"Kulinarische Stadtführung"

An der Spitalkirche (Bildmitte) gibt es einen kleinen Parkplatz (mit Parkschein
2h von 8 bis 18 Uhr). Von dort ist man sehr schnell
am Treffpunkt für die Stadtführungen (rosa Haus zwischen Spitalkirche
und St. Jakob) oder am Marktplatz.

Hier startete also
auch die kulinarische Stadtführung bei der wir, weil der Termin in den
November
verschoben worden war, Schwandorf bei Nacht entdecken konnten - auch nicht verkehrt!
Als erstes ging
es vorbei am neuen Rathaus. Zwei Trakte des ehemaligen Elisbeth-Spitals wurden
2003 renoviert und durch einen Neubau dazwischen ergänzt. Zwei komische
Vögel bewachen den Eingang.


Um diese Jaherszeit präsentiert sich der Vorplatz am Eingang bei dieser Beleuchtung recht mystisch.
Ca. 100 Meter weiter
am unteren Marktplatz fiel uns dieser öffentliche Bücherschrank auf,
wo man völlig unbürokratisch Bücher ausleihen oder tauschen kann.
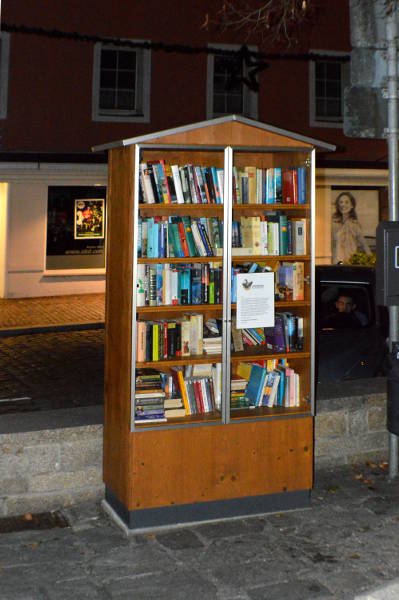
Auch der Prospekt mit der Jakobskirche hat am Abend einen besonderen Reiz.

Weiter gings durch
die Brauhausstraße zur Hufschmiede, wo ein kühles Pils und eine kleine
Auswahl an Tapas
auf uns warteten.
An der Stadtmauer
entlang steuerten wir danach die nächste Station an. In der Weinstube an
der Weinbergstraße gab's
als zweiten Gang eine Winzersuppe. Zuvor trafen wir auf diese Familie von Vierbeinern.

An der Spitzwegstraße
stießen wir bei einer ganz unscheinbaren "Haustür" auf
einen der Eingänge
zu den Felsenkellern. Wir stiegen hinab ein eine andere Welt.





Der "Elefant" als besondere Sehenswürdigkeit
137 solcher Abteile
sind bekannt und durch ein unüberschaubares Netz von Gängen verbunden.
Eigentlich als Gähr- und Lagerkeller für Bier aber auch für Lebensmitel
gedacht, dienten die Keller im 2. Weltkrieg als
sicherer Unterschlupf für ca. 6000 Menschen in den letzten Kriegstagen
.
60 Keller sind nach der Sanierung durch die Stadt zugänglich und dienen
teilweise als Veranstaltungsort der besonderen Art.
Auf der Weinbergstraße
stiegen wir nun zum Blasturm hinauf.
So ähnlich, nur mit wesentlich weniger Beleuchtung muss
ihn 1860 Carl Spitzweg zu seinem Gemälde inspiriert haben.



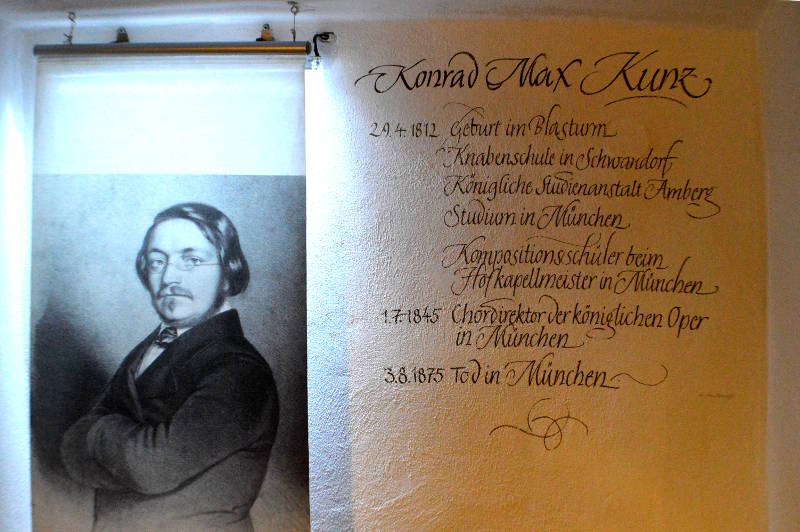
Eine Schautafel im Turm informiert über den Werdegang von Konrad Max
Kunz, der als Sohn des Türmers hier geboren wurde.
Der Turm enthält
auf zwei Stockwerken ein kleines Museum zum Andenken
an Konrad Max Kunz, dem Komponisten der Bayernhymne.
Der Hauptgang des Abends erwartete uns im Gasthof "Schmidt Bräu".

Dieses Mal gab es auch eine Nachspeise. Kredenzt wurde sie im "Süßen Eck", rechts unten am Markt.

