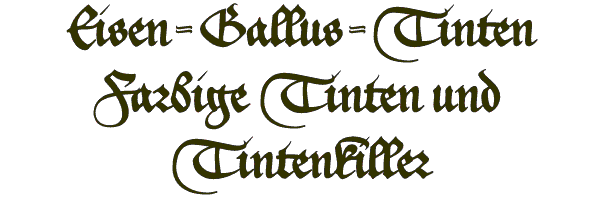Überarbeitet und ergänzt September 2017, Oktober 2017
![]()
Übersicht:
1. Chemische und historische Hintergründe
2. Historische Eisen-Gallus-Tinten
2.1 Ein einfaches
Grundrezept
2.2 Weitere
historische Rezepturen
2.2.1
Ein andere Dinten
2.2.2
Ein andere
2.2.3
historische Instanttinte
2.3 Das
ganz exotische Rezept
2.4 Neue Rezepturen
2.4.1
Neutrales Schwarz und eine gute Schwärzung bringt dieses Rezept
2.4.2
Tinte von brauner Farbe
3. Dokumentenechte Tinte
4. Farbige Tinten
4.1 Rote
Tinte
4.2 Blaue Tinte
4.3 Gelbe Tinte
4.4
Grüne Tinte
4.5 Drachenblut
5. Tintenkiller
5.1 Abschwächer
für Eisen-Gallus-Tinten
5.2
Heutige Tintenkiller
6. Historische Geheimtinten
Disclaimer
Zusammenfassend für alle aufgeführten Verfahren sei daran erinnert, dass beim Umgang mit Chemikalien die spezifischen Sicherheitsvorschriften einzuhalten sind. Dazu gehört auch das Studium der Sicherheitsdatenblätter, die man im Internet findet oder vom Lieferanten der Chemikalien bekommen kann. Bei gesundheitsgefährdenden Stoffen sind Schutzkleidung, -Brille und -Handschuhe angebracht. Selbstredend darf während dem Umgang mit gefährlichen Stoffen nicht gegessen, geraucht oder getrunken werden. Wer die nachfolgenden Versuche durchführt, tut dies auf eigene Gefahr. Der Autor übernimmt keine Haftung für unmittelbare Schäden oder Folgeschäden jedweder Art.
1. Chemische und historische Hintergründe
Abb. 1: Türkische Galläpfel; das linke Exemplar (Vergleich
mit einer 1Cent-Münze) hat 1,5 cm Durchmesser und wiegt 2,55g
Seit dem 3. Jahrhundert vor Christus ist die Herstellung einer schwarzen
Tinte aus dem in Pflanzengallen (Galläpfeln) enthaltenen Gerbstoff
und Eisensulfat bekannt. Die in pflanzlichen Gerbstoffen enthaltenen Tannine
und Gallussäuren werden durch einlegen in Wasser und anschließendes
Auskochen gewonnen. Neben den an Eichenlaub wachsenden Galläpfeln
sind noch weitere Pflanzen Lieferanten von Gerbstoffen z. B. Eichenrinde,
Rinde von Ulme und Schwarzerle, grüner Tee, Walnussblätter,
Blutwurz sowie die die Blätter und äußeren Schalen der
Edelkastanie. Sie alle enthalten Gallotannine, die wasserlöslich
sind und daher wie oben erwähnt gewonnen werden können. In den
überlieferten Rezepturen aus dem Mittelalter werden daneben auch
Erlenknospen genannt. Heute kann man Gerbsäure und Gallussäure
im Farben- oder Chemiehandel kaufen. Wer es aber gerne absolut authentisch
("a") haben möchte, der muss auf selbst hergestellte Pflanzenauszüge
zurückgreifen.
Der zweite Bestandteil, das Eisen(II)-Sulfat-Heptahydrat kann aus Eisennägeln oder besser Eisenfeilspänen und verdünnter Schwefelsäure hergestellt werden. Dazu gibt man so lange Eisenspäne in die 20%-ige Säure, erhitzt, und wartet bis keine Gasentwicklung (Wasserstoffgas!) mehr festzustellen ist. Dann wird noch im heißen Zustand abgefiltert. Im Filtrat bilden sich bereits beim Abkühlen hellblaue Kristalle, die sich an der Luft zunehmend gelb und schließlich braun verfärben. Die Verfärbung ist auf die Oxidation von zwei- zu dreiwertigem Eisen zurückzuführen. Je nach gewünschtem Verhalten der Tinte ist eine entsprechende Qualität des Eisensulfats einzusetzen. Die Verwendung von frischem Vitriol oder wie in alten Quellen genannt Vietril, ergibt eine Tinte, deren Färbung erst nach einer gewissen Zeit einsetzt. Strebt man eine von vorn herein schwarze Tinte an, dann sollte älteres Vitriol verwendet werden. Eine "Auffrischung" und damit Beseitigung des bräunlichen Tons ist durch Zugabe einiger Tropfen Schwefelsäure an die wässrige Lösung machbar.
Abb. 2: Eisenfeilspäne (unbedingt fettfrei!) Zur Herstellung von
Eisen(II)-Sulfat
Abb. 3: Gekauftes Eisen(II)-Sulfat das schon lange liegt und daher
zum großen Teil bereits oxidiert ist
Tipp: Akkumulatorensäure für Bleiakkus hat eine Konzentration von 37%. Etwas weniger als 1:1 mit Wasser verdünnt kann die technische Säure zur Herstellung von Eisensulfat dienen. Aber Achtung: Die Säure stets in kleinen Portionen ins das Wasser einrühren, niemals umgekehrt! Selbstverständlich sollte das Tragen von Schutzbrille und Schutzhandschuhen sein. Spritzer von Schwefelsäure hinterlassen hässliche Löcher in Kleidung, allen organischen Stoffen also auch in menschlicher Haut!
Werden Gerbsäurelösungen und Eisen(II)vitriollösung gemischt, dann entsteht ein farbloser Eisen-Gallus-Komplex, der sich durch Oxidation durch Luftsauerstoff schwarz färbt. Dabei wird das Fe2+ in Fe3+ übergeführt. Der Grund, weshalb einer Tinte, die mit frischem Vitriol hergestellt und unter Luftabschluss gelagert wurde ein weiterer färbender Zusatz untergemischt wurde, ist ganz einfach der, dass der Schreiber sonst die Schrift mit der nahezu wasserklaren Tinte schlecht sehen konnte. Derlei Tinten werden auch heute noch zum Unterschreiben wichtiger Dokumente benutzt. Die wässrige Lösung dringt in das Papier ein, bevor die Schwarzfärbung eintritt. Diese findet dann nicht nur an der Oberfläche statt sondern auch in tieferen Schichten der Papierfasern. Das macht die Schrift nahezu unauslöschlich. Findet die Oxidation bereits vor dem Auftrag auf das Papier oder Pergament statt, erhält man eine von vorn herein schwarze Schrift, die aber weitgehend an der Oberfläche verbleibt. Je mehr dreiwertiges Eisen bei der Herstellung der Tinte enthalten ist, desto schwärzer gerät sie von Anfang an.
Ach ja, weiter unten brauchen wir noch den Anteil von metallischem Eisen im Eisen(II)-Sulfat Heptahydrat. Nach Befragen des PSE (Periodensystem der Elemente) und ein wenig Artithmetik ergibt sich die molare Masse zu 277,1 g. Davon sind 55,8 g metallisches Eisen. Anders ausgedrückt in einem Gramm Eisenvitriol sind 0,2 g Eisen enthalten.
Weitere Zusätze zu gut verarbeitbaren Tinten sind Gummi Arabicum als Bindemittel und zum Verbessern der Fließeigenschaften, Salz und Essig als Konservierungsmittel und Alaun um Ausflockungen zu verhindern. In manchen Rezepten wird auch Bier, Wein oder Ethanol zugesetzt. Gummi Arabicum und diverse weitere exotische Harze kann man von der Firma Kremer Pigmente beziehen wie auch die meisten anderen Zutaten.
Abb. 4: Gummi arabicum Stückchen und Alaunkristalle rechts
Abb. 5: Tanninpulver links und Gallussäurepulver
Leider kann man nicht so ohne weiteres den Gehalt an Gallussäure im Galläpfelsud bestimmen. Laut Wikipedia sollen in Galläpfeln ca 60% Gerbstoffe und Tannine enthalten sein. Das würde pro Gramm Gallapfelgranulat also etwa 0,6 g Tannin entsprechen. Anders herum gerechnet, entspricht 1g Tannin einer Menge von 1,67g Galläpfeln.
2. Historische Eisen-Gallus-Tinten
Bei meinen Recherchen bin ich auf vielerlei Rezepturen gestoßen, von denen hier einige wiedergegeben werden seien.
2.1 Ein einfaches Grundrezept
Es steht so in "Artliche Künste weise Dinten und allerhand Farben zubereiten..., Erffurdt 1532"
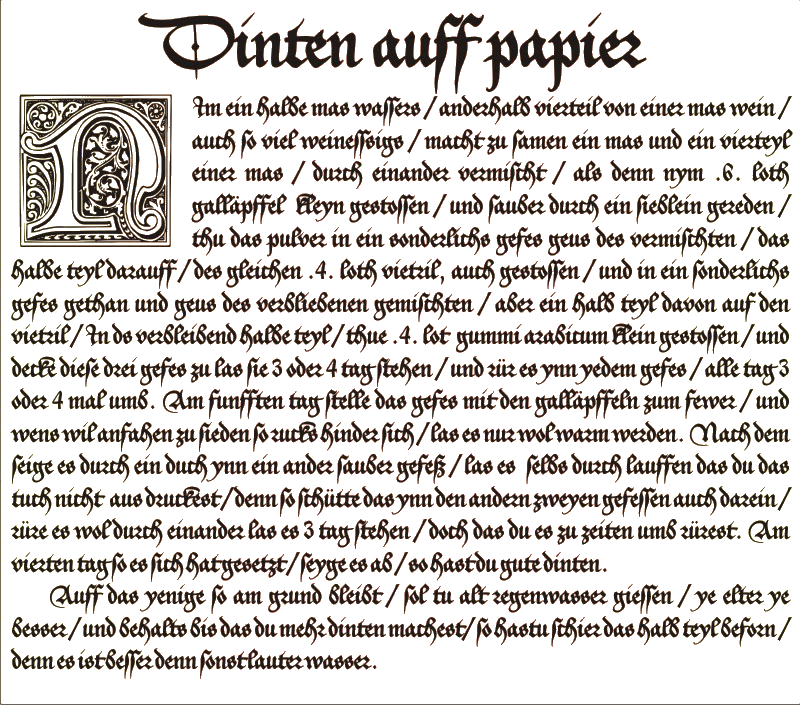
Das Rezept umzusetzen bedarf es einiger zusätzlicher Informationen. 1 mas entsprach zu jener Zeit wohl etwa 1,67 Liter, eine Kanne 0,94 Liter. Ein Nösel entspricht im Durchschnitt 0,45 Liter. Die Angaben für 1 Loth weichen regional ebenfalls etwas von einander ab. Auf die Gegend um Sachsen herum bezogen, entspricht das einer Masse von ca. 14,6 Gramm. Ein Quentlein (Quentchen, Quintin...) ist 1/4 Loth also 3,65 Gramm. Zwei Loth sind 1 Unze, was 29,2 Gramm entspricht. Die Angaben, welche man dazu findet sind leider oft unvollständig oder weichen stark voneinander ab.
Türkische Galläpfel von der Firma Kremer haben das Stück etwa 2,5 g bei einem Durchmesser von ca. 1,5 cm. Bei der letzten Lieferung waren bedeutend größere Exemplare dabei. Die getrockneten Gallen sind sehr hart so dass es eines Hammers zum Zerkleinern bedarf. Gut geeignet sind auch die massiven Mörser aus Granit aus dem Chinaladen.
Die Herstellung des Eisenvitriols wurde weiter oben bereits beschrieben. Natürlich wird wohl niemand die in diesem und den anderen Rezepten angegebene Menge zum Ausprobieren ansetzen wollen. Deshalb habe ich für die (freie) Übersetzung des Textes aus dem ersten Rezept alle Maßangaben mit dem Faktor 0,025 multipliziert. Alles zusammen ergibt sich nach dem Filtern ein Volumen von ca. 50 cm³. Versuche nach verschiedenen Zeiten der Fertigstellung zeigten stets ein sehr gutes Ergebnis auf diversen Papiersorten. Dabei spielte es keine Rolle, ob die Tinte offen oder gegen Umgebungsluft abgeschlossen aufbewahrt wurde. Grundsätzlich ergab sich eine fast sofort einsetzende Schwärzung auf Recyclingpapier während dieselbe auf glattem, weißem Papier wesentlich mehr Zeit in Anspruch nahm.
Geräte:
- 1 Kunststoffbecher oder eine alte Tasse zum Anmischen der Flüssigkeiten
- 1 Rundkolben 50ml hitzefest
- 2 Reagenzgläser
- 3 Gummistopfen
- Trichter
- Mörser
- Filterpapiere (Kaffeefilter)
- Latexhandschuhe
Material
- Wasser (destilliert) 21cm³
- Wein 16cm³
- Essig 16cm³
- Galläpfel 2,5g
- Eisenvitriol 1,7g
- Gummi arabicum 1,7g
- Schwefelsäure ein paar Tropfen
In den Rezepten ist oft von Regenwasser die Rede. Gemeint ist damit weiches Wasser ohne Kalk und Mineralienanteil. Ich ersetze es durch Deionat, das ist das "destillierte" Wasser, das man zum Befüllen von Dampfbügeleisen und der Gleichen verwendet. Ob Regenwasser, gerade in Städten, heute so sauber ist, dass es mit Deionat konkurrieren kann, ist zumindest zweifelhaft. Im Kunststoffbecher mische also Wasser, Wein (weiß oder rot spielt keine Rolle) und Essig (nomaler Haushaltsessig, keine Essigessenz!). Die Hälfte davon (26cm³) kommt in das hitzefeste Gefäß, jeweils die Hälfte vom Rest gieße in je ein Reagenzglas oder ein anderes kleines Fläschchen. Metallgefäße sind für den Zweck unbrauchbar! Nachdem die Gefäße abzudecken sind, sollte man passende Deckel oder Korken bereit halten.
Durchführung
Im Mörser werden die Galläpfel zerkleinert. Das Sieben kann unterbleiben, da wir nicht durch ein Tuch abseihen sondern filtern und damit auch die feinsten Partikel zurückhalten können. Die zerkleinerten Galläpfel kommen in das hitzefeste Gefäß. Verschluss drauf- durchschütteln.
Abb. 6: Gummilösung, Galläpfel und Eisensulfat in der Wasser-Wein-Essig-Mischung
Das Eisensulfat kommt in eines der Reagenzgläser. Evtl. 3-4 Tropfen Schwefelsäure hinzufügen (steht nicht im Original-Rezept), Verschluss drauf, schütteln, bis sich alles gelöst hat. Die Schwefelsäure sorgt dafür, dass bereits oxidiertes Eisen(II)sulfat, das sind die braun verfärbten Stellen, wieder reduziert werden. Je mehr bräunliches Material in die Brühe kommt, desto schwärzer ist der Auftrag sofort beim Schreiben. Allerdings fällt dann beim längerren Lagern auch eher und mehr Bodensatz aus.
Liegt das Gummi arabicum nicht in Pulverform (für Lebensmittel) sondern in körniger Form vor, dann sollte man diese Brocken auch möglichst zerkleinern. Portionsweise ins letzte Reagenzglas füllen und jeweils schütteln. Zukorken und alle drei Gefäße an einem warmen Ort beiseite stellen.
Alle drei Gefäße, vor allem den Gallenansatz, mehrmals täglich durchschütteln.
Nach 3-4 Tagen wird der Gallenansatz bis kurz vor dem Sieden erhitzt. Er soll gut warm werden aber nicht sieden. Es ist keine Zeitdauer dafür angegeben aber ich halte den Ansatz ca. 10 Minuten gut warm. Danach wird in ein sauberes Glas heiß abfiltriert und in dieses Gefäß auch der Inhalt der beiden Reagenzgläser geschüttet und gut durchgerührt.
Abb. 7: Sieden im hitzefesten Rundkolben, Filtern und fertige Tintenmischung
Die Mischung bleibt 3 Tage (abgedeckt) stehen und wird immer mal wieder geschüttelt oder gerührt. Am vierten Tag wird noch einmal gefiltert und luftdicht abgefüllt.
Der Autor der ursprünglichen Fassung empfiehlt den ersten Filterrückstand mit einer halben mas wassers aufzugießen und für die nächste Zubereitung aufzubewahren. Wer also vor hat, das gleiche Rezept ein weiteres Mal anzusetzen gibt den Filterrückstand in ein Fläschchen und füllt 21 cm³ Wasser auf.
Abb. 8: Schriftprobe auf gutem, weißem Papier (oben) sowie auf
Recyclingqualität in jeweils 1-minütigem Abstand zwischen den
Zeilen. Die jeweils 4. Zeile entstand zum Schluss.
,Anhand der Schriftproben ist gut zu ersehen, dass bereits nach einer Minute eine gute Schwärzung erreicht ist. Nach zwei Minuten ist die Reaktion mit dem Luftsauerstoff nahezu abgeschlossen.
In Anlehnung an Rezept 1 habe ich einige Ergänzungen zur Verbesserung vorgenommen. Der Gerbstoffanteil wurde durch Hinzufügen von 0,5g reiner Gallussäure erhöht. Auch wurde der Eisenanteil um 1g Eisenvitriol angehoben. Zur Schonung von Stahlfedern wurde dem Ansatz ferner 0,5g Kupfer-(II)-Sulfat hinzugefügt. Die Feder wird dadurch automatisch verkupfert und kann so von der, in der Tinte enthaltenen Säure nicht mehr angegriffen werden.
Um die Haltbarkeit zu erhöhen, kann man als Konservierungsmittel Salicylsäure oder besser ein Salicylat in geringer Menge zusetzen. Da Salicylsäure schlecht wasserlöslich ist, setzt man diese am besten vorher mit Kaliumcarbonat (Pottasche) oder Natriumhydrogencarbonat (Backsoda) zum Salicylat um. Zu diesem Zweck werden 1,38g Salicylsäure und 1,56g Kaliumcarbonat-Monohydrat in etwa 10cm³ Wasser zur Reaktion gebracht. Unter leichter Gasentwicklung (CO2 entweicht) entsteht Kaliumsalicylat, welches gut wasserlöslich ist. Von der klaren Lösung wird ca. 1cm³ dem Tintenansatz hizugefügt.
2.2 Weitere historische Rezepturen
Es steht so in "Artliche Künste weise Dinten und allerhand Farben zubereiten..., Erffurdt 1532"
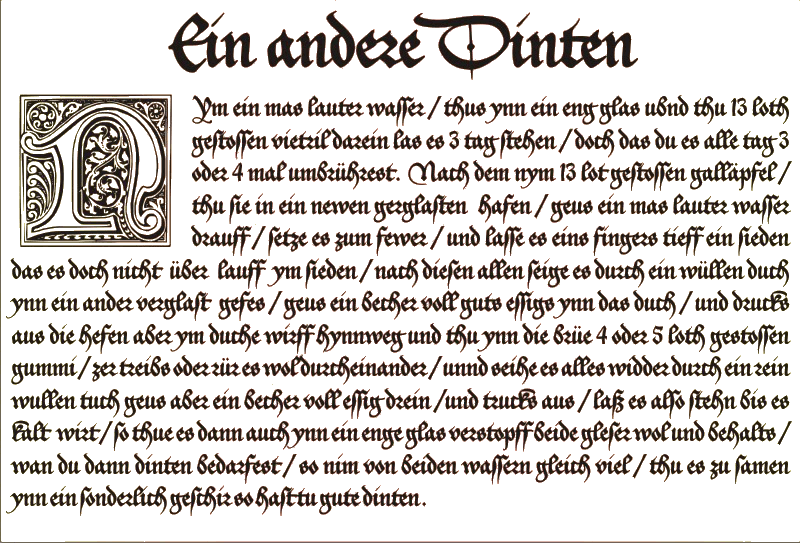
In heutigem Deutsch geht's so:
- Wasser 1,6 Liter
- Eisensulfat190g
- Wasser 1,6 Liter
- Galläpfel 190g
- Essig 2 mal 1Glas
- Gummi arabicum 60 g
Fülle 1,6 Liter reines Wasser in eine Flasche und gib 190g Eisensulfat dazu. Verschlossen drei Tage rasten lassen und 3 bis 4 mal umrühren oder durchschütteln nicht vergessen. In ein hitzefestes Gefäß - Emailliert oder Glas, keine metallene Oberfläche - kommen 1,6 Liter reines Wasser und 190 g zermörserte Galläpfel. Erhitze bis zum Sieden und lasse etwa ein Finger tief Wasser verdampfen. Acht geben, es kocht leich über! Danach gieße durch ein wollenes Tuch in ein neues glasiertes Gefäß ab und füge ein Glas Essig hinzu. Den Filterrückstand wegwerfen und zum Filtrat etwa 60g klein gestampftes Gummi arabicum hinzufügen, umrühren, bis alles aufgelöst ist. Nach dem erneuten Filtern durch ein wollenes Tuch, gieße zum Schluss ein Glas Essig in das Tuch und drücke es aus. Abkühlen lassen und in eine Flasche füllen, verkorken. Bei Bedarf gleiche Mengen aus den beiden Flaschen vermischen ergibt gute Tinte.
Der Ansatz über 2 getrennt aufbewahrte Komponenten hat den Vorteil, dass dem Ausflocken entgegengewirkt wird. Ferner kann man wohl davon ausgehen, dass durch das Schütteln der Vitriollösung Sauerstoff aufgenommen werden soll, was einen Teil des Eisens oxidiert und somit sofort eine schwärzende Tinte ergibt. Unklar bleibt, weshalb ein wollenes Tuch zum Filtern verwendet wird.
An verschiedenen Stellen in manchen Quellen wird dringend angeraten, keine glasierten Gefäße zu verwenden. Der Hintergrund dürfte sein, dass die Glasuren oft bleihaltig waren und in Verbindung mit den in der Tinte enthaltenen Säuren somit Blei und andere Schwermetalle aus der Glasur gelöst wurden. Das kann den Tintenansatz verdorben haben.
Es steht so in "Artliche Künste weise Dinten und allerhand Farben zubereiten..., Erffurdt 1532"
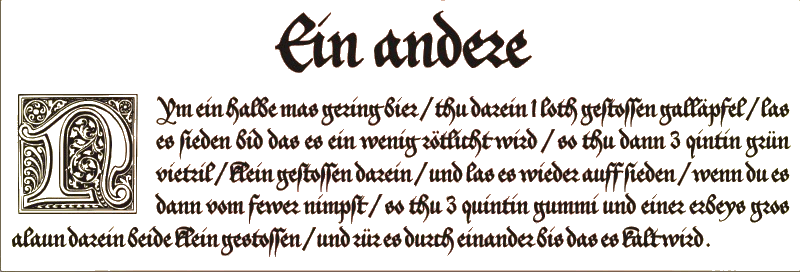
- Bier 0,8 Liter
- Galläpfel 15g
- Eisensulfat (Eisenvitriol) 60g
- Gummi arabicum 60g
- Kalialaun Messerspitze
In 0,8 Liter billigem Bier werden 15 Gramm zerkleinerte Galläpfel gekocht bis die Lösung leicht rötlich wird. Vor einem erneuten Aufsieden werden 60 Gramm zerkleinertes Eisenvitriol hinzugefügt. Vom Herd nehmen und 60 Gramm Gummi arabicum sowie eine erbsengroße Menge Alaun unter rühren dazugeben. Bis zum Erkalten durchrühren.
Hier fehlt wohl das Filtern des Gallapfelsuds. Außerdem werden keine Wartezeiten bis auf das abschließende Rühren angegeben. Entscheidend ist hierfür nicht unbedingt das Erkalten, sondern das vollständige Auflösen des Gummieintrags.
Rezepturen wie die drei angeführten gibt es vielerlei. Sie variieren etwas in der Bemessung der Zutaten und in der dafür aufgewandten Zeit. Beim Durchsehen der verschiedenen Quellen fällt aber auf, dass sich gewisse Zubereitungssvorschriften, zwar nicht im direkten Wortlaut, so doch daran stark angelehnt sowie im Inhalt und den Zutatenmengen wiederholen (siehe weiter unten).
2.2.3 historische Instanttinte
Eine weitere interessante Quelle ist "Kunstbüchlein, wie man auff Marmelstein, Kupffer, Messing..., Helmreich Andreas, Halle 1621". Hier findet sich ein Rezept zur Herstellung von Instanttinte.
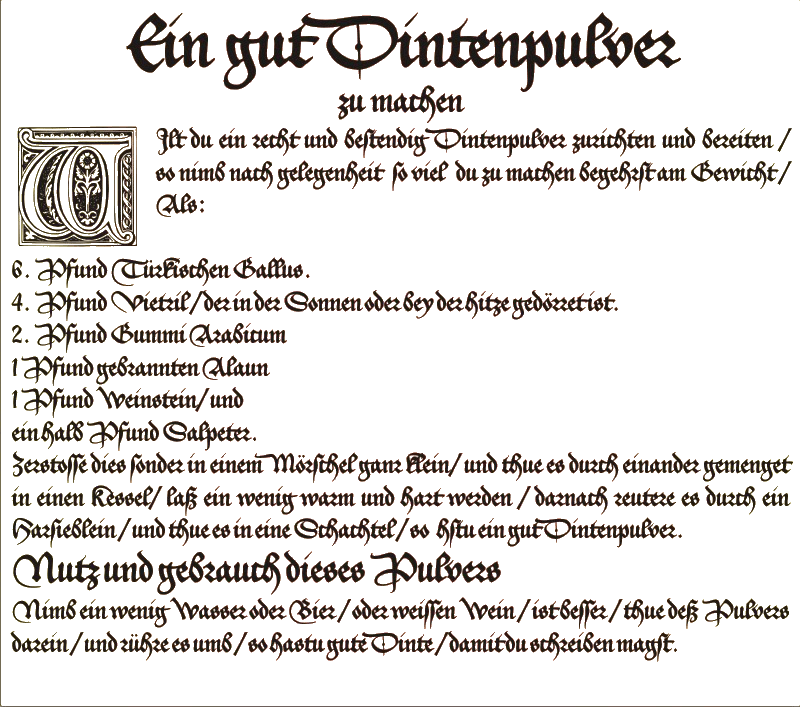
Ein Versuchsansatz könnte lauten auf (die Einheit Pfund wird auf Gramm reduziert):
- 6g Galläpfel (hier ersetzt durch 3,6g wasserlösliches Tannin (Kremer))
- 4g Eisenvitriol (kristallin (Kremer)) entsprechend 0,86 g metallisches Eisen
- 2g Gummi arabicum (Pulver, Lebensmittelhandel Internet)
- 1g Alaun (kristallin (Kremer))
- 1g Weinstein (Weinstein - Kaliumtartrat/Natriumtartrat, kristallin, Apotheke)
- 0,5g Salpeter (Kaliumnitrat feinkristallin, Apotheke, Internet (Pökelsalz))
Die Zutaten werden, falls sie nicht bereits in feiner Form vorliegen getrennt im Mörser zerrieben, vermischt und in ein luftdicht abschließbares Gefäß zur Aufbewahrung gebracht. Eine Schachtel ist meines Erachtens ungeeignet, da Eisen(II)-Sulfat an der Luft schnell unter Wasserabgabe zu Eisen(III)-Sulfat oxidiert. Damit das Pulver möglichst rückstandslos aufgelöst werden kann, wird der Gallusanteil durch Tannin (Kremer) ersetzt. Weil Galläpfel ca. 60% Gerbstoffe enthalten, ergibt sich eine Menge von 3,6g. Der im Original genannte Weinstein, das Kaliumsalz der Weinsäure, ist in Wasser schlecht löslich, wenn es sich um die Kristalle handelt, die sich gern in Weinflaschen am Boden oder am Korken absetzen. Hier handelt es sich um Kaliumhydrogentartrat uhnd Calciumtartrat. Zu verwenden sind Kaliumtartrat oder Natriumtartrat oder eine Mischung daraus, die alle gut wasserlöslich sind. Weil keine weitere Spezifizierung für Salpeter angegeben ist, wird Kalisalpeter = Kaliumnitrat (Pökelsalz) verwendet, der im Gegensatz zu Ammoniumnitrat und Natriumnitrat nicht hygroskopisch ist. Wird die gesamte Mischung in 140cm³ Flüssigkeit aufgelöst, dann entspricht der Ansatz in etwa dem von Rezeptur Nummer 1.
Ein Test der Mischung ergab gleich nach der Auflösung in kaltem Weißwein (12% Alc) eine recht helle Flüssigkeit, die ralativ schnell nachdunkelte. Die Tinte ließ sich auf sehr glattem, weißem, dickerem Papier ebenso wie auf 80g-Recyclingpapier gut randscharf mit einer Blattfeder schreiben. Der Deckungsgrad während des Schreibens ist sehr minimal und nur im Gegenlicht zu erkennen. Ein weiteres Anfärben der Lösung ist daher in Erwägung zu ziehen. Allerdings dunkelt der Auftrag relativ schnell nach und erreicht nach 3 Minuten bereits fast die volle, endgültige Deckung. Für eine Schnelllösung geeignet, aber für optimalere Ergebnisse ist das erste Rezept auf dieser Seite auch die erste Wahl, auch wenn die Zubereitung wesentlich länger dauert.
Abb. 9: Die Schriftprobe lässt erkennen, dass die Schwärzung
nach 1 Minute bereits sehr gut ist während der frische Auftrag noch
sehr transparent erscheint
2.3 Das ganz exotische Rezept
Ein sehr eigenwilliges Rezept einer Tinte fand ich in "Kunstbüchlein, wie man auff Marmelstein, Kupffer, Messing..., Helmreich Areas, Halle 1621". Ich überlasse es dem geneigten Leser, den Originaltext selbst ins Neudeutsche zu übertragen.
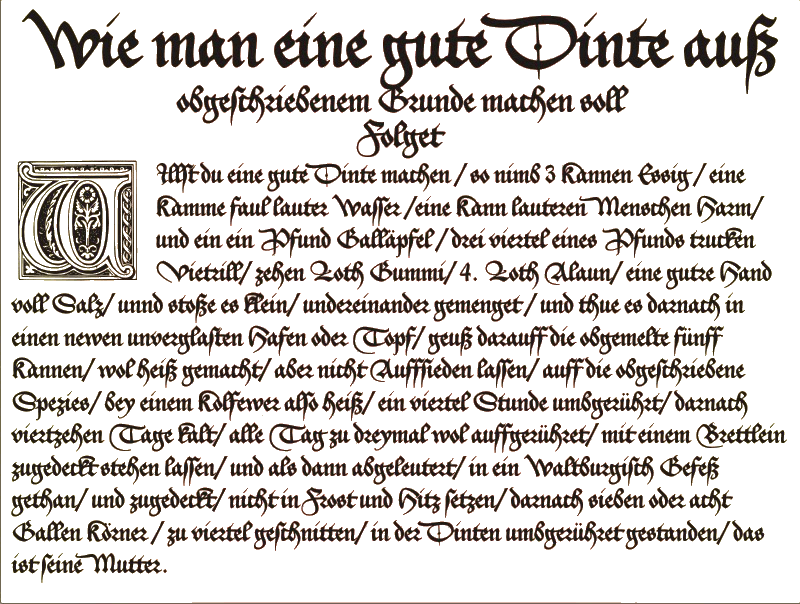
Aufgabe: Überprüfe Gallus- und Vitriolgehalt und stelle eine
volumenmäßig reduzierte Probe her. Übertrage das Rezept
ins Neudeutsche.
2.4 Neue Rezepturen
Auf der Suche nach neuen Rezepturen mit spezifischen Eigenschaften bin ich durch Versuche auf folgende Zusammensetzungen gestoßen.
2.4.1 Neutrales Schwarz und eine satte Schwärzung bringt dieses Rezept
1,8g möglichst reines Eisen-(II)-Sulfat werden in 12 ml destilliertem, heißem Wasser gelöst. Falls sich die Lösung durch das Erhitzen bräunlich verfärbt, kann dies durch Zugabe von einigen Tropfen Schwefelsäure rückgängig gemacht werden. In diese Lösung werden dann auch noch 0,25g Alaun eingebracht und umgerührt bis sich alles gelöst hat.
In einem zweiten feuerfesten Glas werden 1,4g Tannin und 1,0g fein zerstoßenes Gummi Arab. in 12 ml desilliertem Wasser unter Erhitzen bis knapp unter dem Siedepunkt durch Rühren aufgelöst.
Die beiden Lösungen werden zusammen geschüttet und nach einer Standzeit von einigen Tagen abfiltriert. Die Verwendung eines Büchnertrichters und einer zur Saugpumpe umgebauten Aquarienpumpe hat sich dabei als sehr nützlich herausgestellt. Die Schriftprobe bringt eine rasche Schwärzung in neutralem Schwarz. Ausfällungen treten auch bei langer Lagerung kaum auf. Ähnlich wie in Rezept 2.2.1 können die Lösungen aber auch getrennt aufbewahrt und erst vor dem Einsatz zusammengeführt werden. Der Vorteil des Verfahrens liegt vor allem in der kurzen Zubereitungszeit.
Filternutsche mit Aquarienpumpe, darauf vorn eine Filterscheibe
2.4.2 Tinte von brauner Farbe
Eine Tinte von brauner Farbe, die aber nicht durch Holz-, Beeren- oder andere Auszüge pflanzlichen Ursprungs hergestellt wird, enthält neben Tannin und Gummi Arab. anstelle von Eisenvitriol Kupfer-(II)-Sulfat-Pentahydrat. Aus diesem Grund steht dieses Rezept auch nicht im Kapitel "farbige Tinten".
Zutaten:
| Stoff | Menge | Bemerkung |
| Gummi Arabicum | 1,5 g | fein gestoßen |
| Wasser deionisiert | 8 g | erhitzen |
| Tannin | 1,0 g | pulverförmig |
| Wasser deionisiert | 8,0 g | erhitzen |
| Kupfer-(II)-Sulfat | 1,8 g | |
| Wasser deionisiert | 10 g | erhitzen |
| Wasser deionisiert | ad 30 ml |
Ansatz:
Gummi Arabicum wird fein gestoßen und in 8g deionisiertem Wasser
unter Erhitzen und ständigem Rühren gelöst. Es werden weitere
8ml Wasser zugesetzt und wieder unter Rühren und Erhitzen das Tannin
gelöst. In einem zweiten Becherglas löst man auf gleiche Weise
das Kupfersulfat. Die Lösungen werden zusammengeführt und auf
30ml mit destilliertem Wasser aufgegossen - fertig.
Mit der Glasfeder bleibt die Schrift braun
Die Farbintensität nach schwarz hin kann man durch ganz vorsichtige Zugabe (tropfenweise) von Eisensulfatlösung steigern. In einem ersten Versuch stellte sich durch Zugabe von 5ml 7-prozentiger Eisenvitriollösung bereits tiefes schwarz ein.
Wie in Rezept 2.1 am Ende bereits angemerk, werden Stahlfedern durch das enthaltene Kupfersulfat verkupfert und so vor Säureangriffen geschützt.
Die Schriftprobe mit der gleichen Tinte und der Stahlfeder weist bereits
einen starken Schwarzton auf
3. Dokumentenechte Tinte
Unter diesem Begriff versteht man Tinten, die nicht durch bestimmte chemische Reaktionen (siehe Tintenkiller) unsichtbar gemacht oder entfernt werden können. In diese Kategorie fällt auch die Eisen-Gallus-Tinte. Weil der eigentlich farbgebende Prozess nicht bereits vor dem Auftrag der Tinte auf das Papier stattfindet sondern erst nach dem Auftrag und dem Einziehen der Tintenlösung in die Papierfasern, bleibt die Tinte auch nicht nur auf der Oberfläche haften, von der sie leichter zu entfernen wäre
Aus dem Jahr 1933 gibt es eine amtliche Vorgabe betreffend die Eigenschaften von dokumentenechter Tinte. Danach muss im Liter mindestens 27 g Gallussäure und zwischen 4 g und 6 g metallisches Eisen enthalten sein. Es dürfen sich keine Niederschläge in Pulver- oder Blättchenform bilden und die Tinte muss leicht aus der Feder fließen und darf nach dem Antrocknen nicht kleben.
Das Rezept Nummer 1 erfüllt schon mal die letzten drei Forderungen. Selbst nach einem halben Jahr bildete sich im dicht verschlossenen Schraubglas kein Niederschlag. Das Rezept fordert auf 53 cm³ Flüssigkeit 1,7 g Vitriol was einer Menge von 32 g pro Liter entspricht. Darin enthalten sind dann 6,4 g metallisches Eisen. Mithin liegt die Menge knapp über der Vorschrift von 1933.
Das Rezept Nummer 1 verwendet 2,5 g Galläpfel auf 53 cm³ Flüssigkeit. Auf einen Liter hochgerechnet wären das ca. 47 Gramm Galläpfel enthaltend 28 g Tannin. Das sind ca. 60%. Somit entspricht auch das der Vorschrift.
Nach diesen Überlegungen erstellen wir jetzt eine neue Rezeptur aus zeitgemäßen Zutaten. Con algo hay que empezar, ich beginne mit dem Gerbstoffanteil:
- 1,5 g Gallussäure
- 0,5 g Tannin
Das sind 2 g von den geforderten 27 Gramm was den Faktor 0,07407 ergibt und einer Flüssigkeitsmenge von 74 cm³ entspricht. Um auf 6 Gramm Eisen pro Liter zu kommen muss man ca. 28 g Eisensulfat einsetzen und mit 0,07407 multipliziert ergibt das rund 2g Vitriol. Die molare Masse von Eisen(II)-Sulfat-Heptahydrat ist 261,9 g, die von Eisen 55,8g. Das ergibt einen Umrechnungsfaktor von 55,8g/261,9g = 0,2138 oder umgekehrt 4,68. Die Flüssigkeit wird zusammengesetzt aus 37 cm³ deionisiertem Wasser, 18,5 cm³ Weißwein und 18,5 cm³ 5%-igem Essig. Weiters werden zugesetzt eine Prise (Spatelspitze) Alaun, eine Prise Salz oder Salpeter und ein Konservierungsmitel. Letzteres besteht aus einer Prise Salicylsäure, die in 0,5 cm³ Brennspiritus aufgelöst und anschließend mit 1 bis 2 cm³ des Flüssigkeitsansatzes oder destilliertem Wasser verdünnt wird. Dieses Vorgehen ist nötig, da Salicylsäure in Wasser schlecht löslich ist. Die Verarbeitung geschieht im Wesentlichen nach der von Rezeptur Nummer 1 wonach noch, hoch gerechnet, 2,4 Gramm Gummi Arabicum gebraucht werden. Zum Schluss reduzieren wir die Stoffmengen auf einen Ansatz von gesamt 30 cm³.
| Ausgangswert | Faktor | Zielwert |
| 74 |
0,4054 |
30 |
| Stoff | Ausgangsmenge | Zielmenge |
|
Tannin |
0,5 | 0,20 |
| Gallussäure | 1,5 | 0,61 |
| Eisenvitriol | 2 | 0,81 |
| Gummi arabicum | 2,4 | 0,97 |
| Wasser | 37 | 15,00 |
| wein | 18,5 | 7,50 |
| Essig | 18,5 |
7,50 |
Den Inccalulator für EXCEL und Co. kann man hier herunterladen.Auf die langen Zeiten für das Ausziehen der Galläpfel kann durch die Fertigprodukte und Reinstoffe verzichtet werden. Lediglich das Auflösen des Gummis und das anschließende Filtern nimmt etwas mehr Zeit in Anspruch. Das Gummi Arabicum wird in heißer Flüssigkeit aufgelöst und der Rest des Gesamtansatzesunter ständigem Rühren zugesetzt. Zum Schluss wird filtriert. Bei der Zusammenführung der Vitriol-Gummi-Lösung incl. der Spurenbestandteile und der Gerbsäurelösung entsteht eine dunkle Flüssigkeit, die beim Auftrag durch eine Feder auf dem Papier eine leicht graue Schrift hinterlässt.Auf eine Einfärbung durch Azofarben kann man verzichten, da der Schriftzug gut zu erkennen ist und alsbald in ein dunkles Schwarz umschlägt.
Anfängliche Versuchsansätze mit wesentlich weniger Gallussäure und Tannin ergaben eine Tinte, die erst nach ca. 2 Wochen einen guten Schwärzungsgrad erreichte. Für derartige Tinten ist eine andersartige, zusätzliche Einfärbung unumgänglich, weil sonst der Schriftzug beim Schreiben nur schwer zu erkennen ist.
4. Farbige Tinten
Als Grundlage dienen auch hier zum Teil historische Rezepturen. Es ist möglich, den Farbauftrag mit Hilfe der unter dem Kapitel 5.2 Tintenkiller angegebenen Rezepten, ganz oder teilweise zu entfernen. Darüber hinaus sei darauf hingewiesen, dass die hier angeführten Farben allesamt nicht sehr lichtecht sind.
4.1 Rote Tinte
In "Artliche Künste weise Dinten und allerhand Farben zubereiten..., Erffurdt 1532" ist eine rote Farbe aus Presilgen Holz beschrieben. Gemeint ist Rotholz (Lignum fernambuci), das aus Brasilien und Jamaika importiert wird, Das Kernholz der Stämme enthält Brasilin, das durch Oxidation an der Luft zu dem roten Farbstoff Brasilein umgewandelt wird. Der Name Brasilholz stammt aus dem arabischen wo "braza" hellrot bedeutet.
Abb. 10: Geraspeltes Rotholz (Lignum fernambuci)
Jetzt zur Herstellung der roten Farbbrühe. Benötigt wird neben 2,5 g Rotholz 50 cm³ Kalkwasser und 1 g Gummi arabicum. Kalkwasser erhält man, indem man etwas gelöschten Kalk mit Wasser übergießt und einige Stunden stehen lässt bis sich der weiße Niederschlag gesetzt hat. 50 ml der nun klaren Lösung wird vorsichtig in ein hitzefestes Gefäß dekantiert. Nachdem das geraspelte Rotholz hinzugefügt wurde wird der Ansatz erhitzt und 15 Minuten leicht unter dem Siedepunkt gehalten. Die Flüssigkeit färbt sich rasch rot. Jetzt wird heiß gefiltert, das Holz kann noch einmal mit wenig destilliertem Wasser aufgegossen werden. In das Filtrat bringt man das zerkleinerte Gummi und rüht, wieder auf der Heizplatte bis sich alles aufgelöst hat. Die Tinte wird zum Test auf weißes Papier aufgetragen und gegebenenfalls so lange weiter am Köcheln gehalten, bis der Farbton die gewünschte Tiefe erreicht hat. abfüllen und gut verkorken.
Die so gewonnene Tinte ist von einem blaustichigem Rot. Ein hellerer Farbton ergibt sich, wenn man statt des Kalkwassers destilliertes Wasser verwendet. In der oben genannten Quelle wird in einem anderen Rezept Wein als Ansatzflüssigkeit genommen. Das Ergebnis ist eine gelbe Farblösung. Das liegt daran, dass Brasilein in sauerer Umgebung ins Gelbe umschlägt und basisch einen violetten Ton annimmt. Man kann den reinen Rotholzauszug also auch als Säure-Base-Indikator verwenden. Weitere Produktinformationen findet man bei Kremer-Pigmente. Da die Färbung mit Rotholzextrakt nicht sehr lichtecht ist, sollten Schrift und Malereien nicht permanet hellem Licht ausgesetzt werden.
4.2 Blau-violette Farblösung
Mit dem Brasilin aus dem Rotholz ist das Hämatoxylin des Blauholzes (lignum campeche), welches aus Mexico und weiteren Provenienzen stammt, verwandt. Ähnlich wie beim Rotholz wird das Hämatoxylin durch Kontakt mit Luftsauerstoff in Hämatein, den eigentlichen Farbstoff umgewandelt. Letzterer ist besser wasserlöslich und kann durch Auskochen der Kernholzspäne gewonnen werden.
Abb. 11: Blauholzspäne
Zur Zubereitung werden 2,5 g Blauholz werden in 50 cm³ destilliertem Wasser eingeweicht und 20 bis 30 Minuten knapp unter dem Siedpunkt gehalten. Danach wird heiß abgefiltert und evtl. Spuren von Alaun zugesetzt, was den Farbton mehr ins Blaue zieht. Als Bindemittel kann dem Filtrat 1g Gummi arabicum zugeseztzt werden. Nach erneutem Erhitzen der Lösung wird gerührt bis alles aufgelöst ist, abfüllen, verkorken.
Abb. 12: Farbmuster mit verschiedenen Ansätzen von Blau- und Rotholz
bei unterschiedlicher Auftragsstärke
4.3 Gelb
Für eine pflanzliche gelbe Farbe werden reife Kreuzdornbeeren im Mörser zerkleinert und mit destilliertem Wasser angesetzt. Mit etwas Alaun versetzt bleibt der Ansatz ca. 36 Stunden an einem warmen Ort. Danach wird abfiltriert und gut verschlossen aufbewahrt.
Abb. 13: Reife Kreuzdornbeeren
Abb. 14: Schnell mal eine Miniatur mit den drei Farbansätzen gelb-rot-blau
und dem "J" in Eisen-Gallus-Tinte ausgeführt
4.4 Grün
An einem brauchbaren Rezept füt grüne Tinte wird noch geforscht.
4.5 Drachenblut
Drachenblut (Dracaena cinnabari) ist das Harz des Drachenblutbaums, der auf der Insel Socotra - nahe dem Horn von Afrika - beheimatet ist. Das Harz ist rötlich braun gefärbt und kann in Alkohol (Spiritus) gelöst werden. Ein Ansatz aus 2g Harz und 20 cm³ Ethanol ergibt eine Flüssigkeit, die mit Pinsel oder Feder aufgetragen werden kann. Allerdings hat diese "Tinte", die man besser als Lack bezeichnen kann, die Eigenschaft, gleich in das Papier einzudringen. Es bleibt also nur ganz wenig an der Oberfläche stehen, was dazu führt, dass mehrmals aufgetragene Flüssigkeit den Farbton nicht wesentlich verstärkt, wie das beim wässrigen Extrakt von Rotholz oder Blauholz der Fall ist. Dazu kommt, dass die Lösung auf die Rückseite des Papiers durchschlägt.
5. Tintenkiller
Tintenkiller töten selten Schriftzüge sondern machen sie meist nur unsichtbar. Für Eisen-Gallustinten kann nicht einmal von einem Unsichtbarmachen ausgegangen werden sondern allenfalls von einer Abschwächung der Schwärzung. Im historischen Rahmen wird von dieser Maßnahme Gebrauch gemacht, wenn es darum geht, Dokumente, die mit Druckerschwärze auf Rußbasis hergestellt und mit Eisen-Gallustinte bis zur Unkennlichkeit überschrieben wurden, wieder lesbar zu machen. Ansonsten garantiert die Eisen-Gallus-Tinte Unauslöschlichkeit und damit die Eigenschaft, dokumentenecht zu sein.
5.1 Abschwächer für Eisen-Gallus-Tinten
Eigene Versuche haben folgende Ergebnisse gebracht:
Das Überstreichen der Schrift mit einer alkalischen Wasserstoffperoxidlösung verfärbt den Tintenauftrag zu leichten, transparenten Brauntönen. Die Schrift bleibt dennoch gut erkennbar stehen.
Abb. 15: Abschwächung mittels 10%-iger Wasserstoffperoxidlösung,
die mit etwas NaOH alkalisch eingestellt wurde
Der Einsatz von Vanish Bleich- und Entfärbemitteln brachte ein Ergebnis von nahezu Null.
Abb. 16: Fast ohne Bleichergebnis blieb der Einsatz von Vanish Entfärbern
Ein überraschendes Ergebnis brachte der Einsatz einer Oxalsäurelösung, was aber auch nur zu einer Aufhellung aber nicht zum Unsichtbarmachen des Tintenauftrags reichte.
Abb. 17: Bleichen mit Oxalsäurelösung
5.2 Heutige Tintenkiller
Was heute unter Tintenkiller gehandelt wird, wirkt nur auf die synthetischen Tintenfarbstoffe wie sie in den Tintenpatronen für Füllfederhalter enthalten ist. Allerdings wird hier, wie oben bereits erwähnt, die Farbe nicht entfernt, sondern lediglich chemisch in eine auf weißem Papier nicht erkennbare Form übergeführt. Folgender Ansatz erfüllt diesen Zweck
Der synthetische blaue Farbstoff der Schülertinte bildet flache Moleküle, die aufgrund ihrer Elektronenstruktur Licht bestimmter Wellenlängen absorbieren und den Rest, im blauen Bereich, reflektieren. Die Geometrie der Moleküle kann man durch Salze schwacher Säuren (Sulfite und Carbonate) verändern und damit die Absorption von Teilen des Lichtspektrums verhindern. Da nun alles Licht von allen Stellen auf dem Papier in gleicher Weise reflektiert wird, scheint die Schrift verschwunden zu sein. Die Farbstoffmoleküle befinden sich aber, wenn gleich in etwas veränderter Form, noch in den Papierfasern. Plättet man die Farbstoffmoleküle wieder, dann wird auch die Schrift wieder sichtbar - zumindest teilweise bei einer Killersubstanz. Darüber hinaus ändert sich der Farbton der "gelöschten" Schrift leicht ins bräunliche, wenn man das Papier mit einem Heißluftgebläse (Föhn) behandelt. Meine Untersuchungen habe ich in einer Tabelle bildlich zusammengestellt.
Abb. 18: Königsblaue Schülertinte mit verschiedenen "Tintenkiller-Substanzen"
behandelt. Ganz oben zusätzlich mit Wasserstoffperoxid, Mitte mit
den angegebenen Substanzen, unten die Namen der in 6 cm³ Wasser gelösten
Substanzen ( je 0,5 g bis 0,7 g)
Grundsätzlich ist bei allen Killereffekten zu bemerken, dass nirgends eine 100%-ige Entfärbung stattfindet, sondern immer ein leicht rosaner Schleier zurückbleibt, was in der Abbildung nicht eindeutig zu Tage tritt.
Die Wasserstoffperoxid-Lösung wurde 30%-ig verwendet. Die gelöste Stoffmenge betrug bei Na-Thiosulfat, Na-Bisulfit und Heitmann Powerentfärber jeweils ca. 0,7g, bei den anderen Lösungen ca.0,5g auf je 6 cm³ destilliertes Wasser.
Von links nach rechts:
Das Bleichmittel Wasserstoffperoxid (30%-ig) alleine vermag den Farbton der blauen Tinte zwar aufzuhellen aber es gelingt nicht, ein reines Weiß zu produzieren.
Soda oder Natriumcarbonat alleine wandelt den Blauton leicht ins Violette, kann aber erst durch Überstreichen mit Wassersoffperoxid (30%-ig) annähernd das Weiß des Papieruntergrunds reproduzieren.
Natriumthiosulfat liefert sehr zweifelhafte Ergebnisse. Ganz oben zusätzlich mit Oxalsäure und Wasserstoffperoxid, darunter nur mit Wasserstoffperoxid und untere Hälfte nur Natriumthiosulfat.
Kaliumcarbonat, bekannt unter der Bezeichnung Pottasche erzeugt eine Verfärbung ins Violette und bringt zusammen mit Wasserstoffperoxid eine nahezu perfekte Entfärbung.
Ammoniumcarbonat, gehandelt unter der Bezeichnung Hirschhornsalz, bringt alleine eine ganz leichte Aufhellung (evtl. bedingt durch Farbabtrag durch den Wattebausch beim Überstreichen). Erst durch zusatz von Wasserstoffperoxid verbleicht der Tintenauftrag.
Oxalsäure vermag selbst durch nachträgliches Überstreichen mit Wasserstoffperoxid den blauen Farbstoff nicht vollständig zu vernichten.
Wird Natriumbisulfit in Wasser gelöst entsteht Natriumhydrogensulfit, ein starkes Reduktions- und Entfärbungsmittel. Die blaue Tinte wird beim Überstreichen sofort "gebleicht", der Untergrund kommt fast verlustlos durch. Beim Übertupfen mit Wasserstoffperoxid (obere Hälfte der Farbfläche) kommt ein Teil der Blaufärbung dezent zurück.
Der "Heitmann Powerentfärber intensiv" erledigt die Arbeit wirklich (fast) perfekt. Die Entfärbung findet beim Überstreichen sofort mit einem leichten, remanenten Schleier statt. Auch ein Überstreichen mit Wasserstoffperoxid kann daran nicht viel ändern.
Fazit:
Für Schüler: Wenn der Tintenkillerstift nichts mehr hergibt, dann fülle ihn mit einer Lösung von Heitmann Powerentfärber intensiv. Das hat zusätzlich den Vorteil, dass gelöschte Schrift nur noch ganz andeutungsweise rekonstruierbar ist.
Für Lehrer: Versucht doch zum Wiederherstellen der mit Tintenkiller gelöschten Stellen, diese mit Wasserstoffperoxid vorsichtig zu überpinseln. Vielleicht könnt ihr den verborgenen Text dann doch wieder (für kurze Zeit) entziffern.
Die hier untersuchte blaue Tinte (von Herlitz) ließ sich mit Carbonaten in Verbindung mit Wasserstoffperoxid fast perfekt löschen. Das kann bei anderen Produkten natürlich unter Umständen anders aussehen. Entsprechende eigene Untersuchungen werden hiermit ausdrücklich empfohlen.
Die Farbwirkung der farbigen Tinten aus dem Kapitel 4 kann mit den hier beschriebenen Mitteln reduziert oder entfernt werden.
6. Historische Geheimtinte
Es steht so in "Artliche Künste weise Dinten und allerhand Farben zubereiten..., Erffurdt 1532"
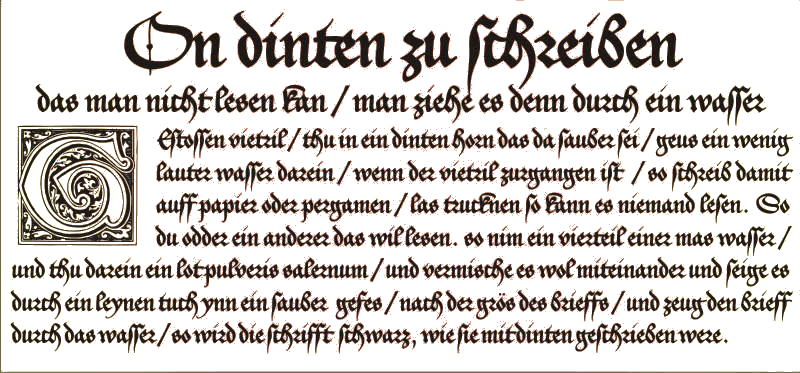
Die Idee, das Zweikomponentensystem der Eisen-Gallus-Tinten für Geheimbotschaften zu verwenden hatte auch schon der Autor des oben zitierten Büchleins. Dazu schreibt er mit einer Eisenvitriollösung und lässt eintrocknen. Sofern das Papier keine Gerbstoffe enthält, kann man die Schrift auf einer unruhigen Oberfläche nicht erkennen. Der Empfänger kann die Schrift sichtnar machen, wenn er einen Galläpfelauszug mit einem weichen Schwamm oder Küchentuch auf die Papieroberfläche aufbringt.
Ich war erstanut, als ich diese Rezeptur fand, denn ich hatte vor einem halben Jahr die Artikel über Geheimschriften verfasst und mir dabei ein ähnliches Verfahren überlegt. Mein Vorgehen war aus gutem Grund umgekehrt. Die Schrift wird mit Galläpfellösung auf das leicht gelbe Papier gebracht. Dabei spielt es keine Rolle ob das Papier Gerbstoff enthält, es kann keine Verfärbung eintreten. Zum Lesbarmachen der Schrift wird Eisenvitriollösung aufgebracht.
Ein Weiteres ist bei der Recherche aufgefallen. Das oben zitierte Werk sehe ich als Vorlage für ein weiteres Buch. Abgeschrieben hat man offenbar auch schon zu jener Zeit, denn 1562 erschien ein Buch zum Thema Farben und Tinten, "Jlluminierbuch künstlich alle Farben zumachen vnd zu bereiten..., Boltz von Ruffach, 1562" in dem unverkennbar die Rezepturen aus dem erstzitierten Buch übernommen sind. Das zweite Werk ist übrigens als Neudruck bei Kremer erhältlich. "On dinten zu schreiben" findet sich in der Onlineausgabe der Unibibliothek Heidelberg auf Seite 132 "Von schwarzer Geschrift".
![]()